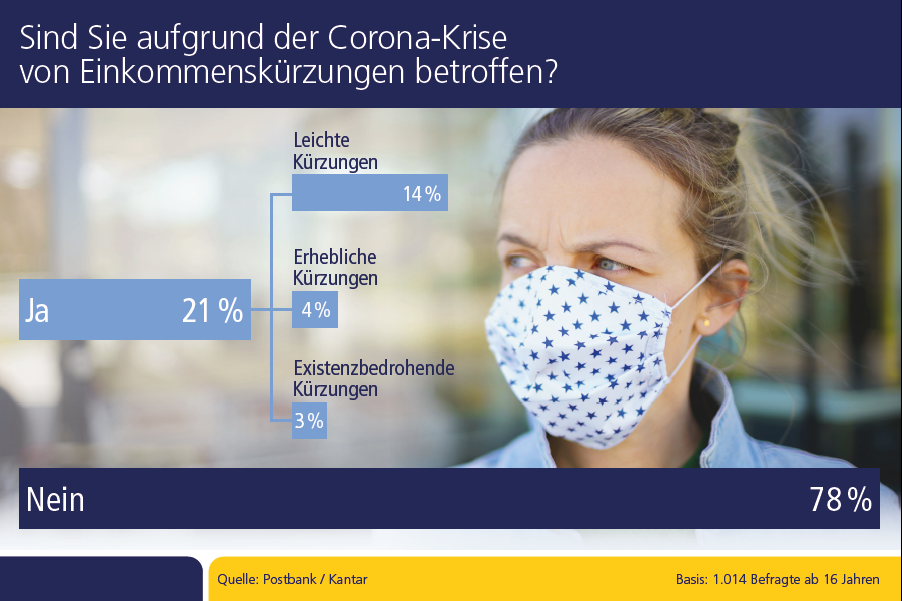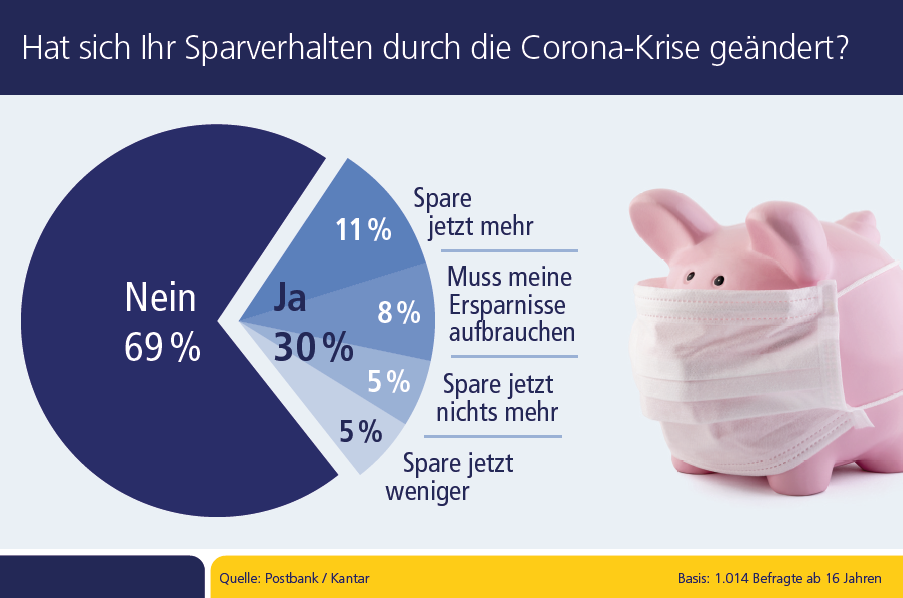„Größter Wirtschaftseinbruch seit Bestehen der Bundesrepublik“, „Voranzeigen bei Kurzarbeit übertreffen die Krise 2008“ – nur zwei Titelmeldungen von vielen. Klar ist: Die durch Corona ausgelöste Wirtschaftskrise ist eine der schwersten der letzten Jahrzehnte. Teils erleben wir die damit einhergehende Not schon jetzt im Freundes- oder Bekanntenkreis, teils wird sie erst sichtbar werden.
Wir sollten daher nicht diskutieren, OB wir einen Wachstumsimpuls brauchen werden – sondern lieber darüber, WIE dieser aussehen sollte, damit er nicht wie ein Strohfeuer a la Abwrackprämie kurzfristig verpufft.
Denn Krisen sind immer auch Katalysatoren für Veränderungen, da sie bereits bestehende Megatrends beschleunigen. Daher sollten wir den Neustart der Wirtschaft verknüpfen mit der ohnehin notwendigen Modernisierung unseres Landes und unseres Kontinents. Und wir sollten beherzt handeln – weil in Krisen immer mehr möglich ist, als vorher möglich war. So lässt sich der Boden für das Wachstum von etwas Neuem bereiten. Dann kann aus einem Konjunkturpaket ein Modernisierungspaket, ja sogar ein nachhaltiger Modernisierungssprung werden. Genau das schlagen wir vor:
Erstens: Starten wir eine Offensive für eine moderne Infrastruktur!
Vieles, für das man früher sogar ins Flugzeug gestiegen ist, geht plötzlich auch vom heimischen Schreibtisch aus. Zugleich wird schmerzlich klar, woran es immer noch hapert: an einer wirklich flächendeckenden Breitband- und Mobilfunkversorgung. Jetzt wäre es höchste Zeit für den Ausbau der digitalen Netz-Infrastruktur. Wann, wenn nicht jetzt, sollten wir zudem ein europäisches Hochgeschwindigkeitszugnetz bauen, das sich endlich nicht mehr hinter dem Japans oder Chinas verstecken muss – und so Klima und Zeitkonto der Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen entlastet?
Das wäre Leitprojekt und Sinnbild eines europäischen Recovery-Programms – für ein Europa, das in der Krise eben nicht zerbricht und die Grenzen schließt, sondern enger zusammenwächst. Anstelle von Kaufprämien sollten wir das europaweite Schnellladenetz für Elektroautos so dicht knüpfen, dass es den Bürgern die Angst vor der Langstrecke nimmt. So unterstützen wir auch die für uns alle so wichtige Autoindustrie bei der Transformation durch einen stärkeren heimischen Markt. Und schließlich zeigt der aktuelle Fokus einmal mehr, dass unsere Schulgebäude weit mehr als einen neuen Anstrich brauchen. Hier eine nationale Kraftanstrengung durch den Bund zu starten ist geboten – anders als beim Digitalpakt diesmal unbürokratisch.
Zweitens: Modernisieren wir unser Steuer- und Abgabensystem!
Als Startimpuls könnten eine ganz neue Idee ausprobieren: Warum lassen wir den Staat nicht bei allen Neueinstellungen die Sozialversicherungsbeiträge bis Jahresende 2020 aus Steuermitteln übernehmen? Der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber hat dies kürzlich vorgeschlagen, damit die Einstellungsdynamik nicht wegbricht, weil unsere bisherigen Maßnahmen, wie die Kurzarbeit, vor allem auf die Sicherung bestehender Beschäftigungsverhältnisse abzielen.
Entlasten wir die Bürgerinnen und Bürger zudem dauerhaft, gerade mit kleinen und mittleren Einkommen. So kurbeln wir den Binnenkonsum an und schließen eine Gerechtigkeitslücke – damit Deutschland nicht mehr die nach Belgien zweithöchste Belastung ausgerechnet denjenigen zumutet, die auch in der Corona-Krise die größte Last getragen haben und durch harte Arbeit aufsteigen wollen.
Und wann, wenn nicht jetzt, sollten wir unser Unternehmenssteuerrecht modernisieren, das schon lange im internationalen Vergleich negativ auffällt? Eine degressive Abschreibung könnte in den Unternehmen dauerhaft Erneuerung fördern. Und wenn wir das Steuer- und Abgabesystem anpacken, sollten wir das geförderte Bildungssparen gleich mit regeln und Deutschland zum Vorreiter bei der Mitarbeiterkapitalbeteiligung machen. Gerade in Start-Ups – für Fachkräftegewinnung, bessere Aktienkultur und damit langfristigen Vermögensaufbau.
Drittens: Verstehen wir Klimaschutz richtig!
Manche nehmen Corona zum Vorwand, alles in Frage zu stellen, für andere ist der wirtschaftliche Niedergang der Königsweg zur Emissionsreduktion – beides ist grundfalsch. Stattdessen sollten wir jetzt endlich ernst machen mit Klimaschutz durch Innovation. Ein Beispiel ist das Zukunftsthema Wasserstoff, ohne den die Pariser Klimaziele nicht zu schaffen sein werden. Mit einem Markthochlaufprogramm könnten wir hier Deutschland entschlossen zum Leitmarkt machen.
Wichtige Bausteine wären der Aufbau einer Wasserstoff(lade)infrastruktur sowie der Wegfall regulatorischer Hürden bei der Nutzung der Erneuerbaren Energien, wie des Einspeisezwangs und doppelter Netzentgelte. Die Belastung der privaten Verbraucher sowie der Unternehmen durch hohe Steuern und Abgaben auf Strompreise muss auch reduziert werden. Das stützt den konjunkturellen Aufschwung und beendet die Absurdität, dass auch sauberer Strom verteuert wird.
Schließlich sollten wir uns kürzere Planungs- und Genehmigungsverfahren zutrauen. Die Krise hat gezeigt, wie Verfahren zu beschleunigen sind, wie unbürokratisch Prozesse ablaufen können. Diesen Spirit brauchen wir jetzt endlich auch bei großen Infrastrukturprojekten und dem Ausbau der Strom- und Gasnetze für Erneuerbare Energien.
Viertens: Passen wir Gesetze und Verwaltung an unser digitales Zeitalter an!
Selbständige und Freelancer fühlen sich in dieser Krise schmerzlich als Erwerbstätige zweiter Klasse behandelt – dabei müssen wir gerade ihre Innovationskraft im Aufschwung nutzen. Viele Menschen freuen sich darauf, irgendwann das Homeoffice verlassen und wieder ins Büro gehen zu können. Gleichzeitig ist klar, dass künftig mehr Menschen öfter selbst entscheiden wollen, wann und von wo sie arbeiten. Wann, wenn nicht jetzt, sollten wir also einen Rechtsrahmen für mobiles Arbeiten samt einem modernisierten Arbeitszeitgesetz schaffen. Die Niederlande unter dem Liberalen Mark Rutte haben es uns vorgemacht. Während der Krise konnten die Menschen sich zudem digital arbeitslos melden, von zu Hause ihr Hochzeitsaufgebot bestellen und viele weitere Behördengänge von der Couch aus erledigen. All das war vorher angeblich nicht möglich – und sollte nach der Krise unbedingt möglich bleiben, weshalb Gesetze von allen unnötigen persönlichen Vorspracheregeln und dergleichen befreit werden müssen. Einen Schub muss es auch für sichere und datenschutzkonforme Daten-Anwendungen und Forschung zu Künstlicher Intelligenz und eHealth geben, wie nicht nur die aktuelle Diskussion um eine Corona-Tracing-App zeigt. Genau jetzt ist die Zeit für die Vollendung des digitalen Binnenmarkts in Europa.
Die Frage des richtigen Zeitpunkts für einen Wachstumsimpuls wird noch kompliziert genug. Wir sollten daher mit einer Verständigung über den Inhalt schon jetzt starten. Entlang der skizzierten Leitlinien könnte nicht nur ein Modernisierungspaket entstehen, sondern auch ein neuer Konsens aus der Mitte heraus. Ein Konsens, der immer nur dann gelingt, wenn alle bereit sind, nicht zurück, sondern nach vorne zu blicken und über den eigenen Schatten zu springen. Jetzt wäre die Zeit dafür!
Auch veröffentlicht im HANDELSBLATT am 6. Mai 2020
Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Johannes Vogel